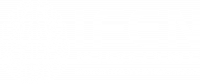Die quantitative EEG-Analyse (qEEG) ermöglicht einen präzisen Blick auf neuronale Aktivitätsmuster. In diesem Artikel erfahren Sie, wie qEEG funktioniert, wo es klinisch eingesetzt wird – und warum es im Neurofeedback längst unverzichtbar geworden ist.
1. Vom visuellen EEG zur quantitativen Analyse
1.1 Signalaufzeichnung und Vorverarbeitung
Die EEG-Aufzeichnung erfolgt über Ag/AgCl-Elektroden nach dem 10–20-System. Typischerweise wird in Ruhezustand (Augen offen/geschlossen) gemessen, ggf. ergänzt durch Aufgaben-EEGs. Durch digitale Filter und Artefaktkorrekturen (z. B. Entfernen von Augen- und Muskelartefakten) wird die Datenqualität verbessert.
1.2 Frequenzbänder und Leistungsmessung
Das Spektrum wird in klassisch fünf Bänder unterteilt:
-
Delta (0,5–4 Hz)
-
Theta (4–8 Hz)
-
Alpha (8–12 Hz)
-
Beta (12–30 Hz)
-
Gamma (> 30 Hz)
Für jedes Band werden Leistung (Power) und relative Anteile berechnet.
1.3 Topografische Darstellungen
Über farbige „Maps“ werden lokale Abweichungen auf der Kopfoberfläche visualisiert. Warme Farben markieren Überaktivität, kühle Farben Unteraktivität. So lassen sich regionale Dysbalancen und Hemisphärenasymmetrien leicht identifizieren.
1.4 Normvergleich und Z-Scores
Individuelle Messwerte werden mit einer Normdatenbank (Kontrollproben gleicher Altersgruppe und Geschlechts) verglichen. Abweichungen von mehr als ±2 Standardabweichungen gelten als signifikant und werden als Z-Scores ausgegeben.
1.5 Kohärenz- und Konnektivitätsanalysen
qEEG berechnet die Synchronisation (Kohärenz) zwischen Elektrodenpaaren und leitet daraus funktionelle Netzwerke ab. Abweichungen in der Konnektivität weisen auf gestörte neuronale Kommunikation hin, z. B. bei ADHS, Autismus oder Angststörungen.
2. Klinische Anwendungsgebiete des qEEG
2.1 ADHS und Aufmerksamkeitsstörungen
Häufig zeigt sich ein Übermaß an Theta-Aktivität gepaart mit einem Mangel an Beta im frontalen Kortex. qEEG hilft, gezielt die zu trainierenden Frequenzbänder zu identifizieren.
2.2 Angststörungen und Depressionen
Frontale Alpha-Asymmetrien und Kohärenzmuster geben Hinweise auf emotionale Disbalancen. Ziel ist die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen den Hemisphären.
2.3 Schlafstörungen
Defizite in Delta- und Theta-Bändern können auf Insomnie oder fragmentierte Schlafzyklen hinweisen. qEEG hilft, gezielt erholsamen Tiefschlaf zu fördern.
2.4 Epilepsie und antikonvulsive Medikation
qEEG erfasst neben epileptiformen Mustern auch Veränderungen in hochfrequenten Bändern unter Medikation – ein wertvoller Marker zur Therapiekontrolle.
2.5 Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
Atypische Konnektivität und Asymmetrien in Alpha- und Beta-Bändern sind häufig. qEEG hilft, Trainingsziele für sensorische und soziale Funktionen zu definieren.
2.6 Komplexe Traumafolgestörungen und Dissoziation
ISF-Protokolle (< 0,1 Hz) kombiniert mit qEEG fördern die Regulation des autonomen Nervensystems – entscheidend bei der Behandlung tiefer emotionaler Dysregulation.
3. Vorteile der qEEG-Integration im Neurofeedback
-
Objektive Diagnostik durch Z-Scores und topografische Karten
-
Individualisierte Protokolle, exakt an die gemessenen Abweichungen angepasst
-
Dynamisches Monitoring mit Verlaufskontrolle in Echtzeit
-
Differenzierung von Medikamentenwirkung und Störungsmustern
-
Wissenschaftliche Fundierung zur Stärkung der Professionalisierung
4. Wissenschaftliche Diskurse und Desinformationen
-
„Neurofeedback heilt alle psychischen Störungen“
→ qEEG zeigt: Protokolle müssen individuell angepasst werden. -
„Messwerte lassen sich beliebig interpretieren“
→ Standardisierte Normdaten sichern die Validität. -
„qEEG ist nur für Technik-Freaks“
→ Tatsächlich erleichtert es die tägliche klinische Arbeit erheblich.
5. Vertiefung und weiterführende Ausbildung
Wenn Sie tiefer in die Grundlagen der EEG-Analyse und des quantitativen EEG eintauchen möchten, empfehlen wir den Kurs:
🔗 Fundamentos de Electroencefalograma y EEG Cuantitativo
Dort erlernen Sie kompakt, wie man qEEG-Daten korrekt erhebt, aufbereitet und interpretiert – praxisnah und wissenschaftlich fundiert.
Referenzen
-
Thatcher, R. W. (2012). Handbook of Quantitative EEG and EEG Biofeedback. Anipublishing.
-
Liao, W., et al. (2019). EEG biomarkers for antiepileptic medication response. Clinical Neurophysiology, 130(9), 1501–1510.
-
Arns, M., et al. (2013). EEG markers as predictors of treatment response in ADHD: A meta-analysis. Clinical Neurophysiology, 124(1), 58–73.
-
Sarnthein, J., et al. (2006). Increase of EEG coherence and phase synchrony during sedation. Neuroscience Letters, 395(3), 191–195.
-
Muthukumaraswamy, S. D., et al. (2015). Ketamine alters dynamic oscillatory connectivity in humans. Human Brain Mapping, 36(3), 994–1006.
-
Surmeli, T., et al. (2015). qEEG neurometric analysis-guided neurofeedback treatment in dementia: 20 cases. Clinical EEG and Neuroscience, 46(3), 177–185.