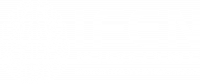Aktualisierter Stand: November 2025
Einleitung
Neurofeedback ist eine nicht‑invasive, therapeutische Form des Biofeedbacks, bei der Patient:innen lernen, ihre eigene Gehirnaktivität – gemessen mittels EEG – bewusst zu regulieren. Durch operante Konditionierung erhalten sie in Echtzeit Rückmeldung über ihre Hirnströme und werden darin geschult, gewünschte neuronale Muster zu fördern und unerwünschte zu hemmen.
Gerade bei medikamentös therapieresistenter Epilepsie – betroffen ist etwa ein Drittel aller Betroffenen – hat Neurofeedback sich als vielversprechende komplementäre Behandlungsoption etabliert. Ziel dieses Artikels ist es, eine umfassende und aktuelle Übersicht über die evidenzbasierte Studienlage zu geben.
Neurophysiologische Grundlagen: Warum SMR‑ und SCP‑Training?
Die Wirksamkeit von Neurofeedback bei Epilepsie beruht auf dem gezielten Training bestimmter EEG‑Frequenzen, die in Verbindung stehen mit der Regulation der kortikalen Erregbarkeit.
-
Sensomotorischer Rhythmus (SMR; 12‑15 Hz): Dieser Rhythmus wird über dem sensomotorischen Kortex gemessen und steht im Zusammenhang mit einem Zustand ruhiger, wacher Aufmerksamkeit und motorischer Hemmung. Frühere Forschung (z. B. Sterman) legte die Grundlage für die Hypothese, dass ein Training zur Erhöhung der SMR‑Amplitude die thalamo‑kortikalen Regelkreise stabilisiert – diese Kreise wirken als eine Art „Torwächter“ für sensorische und motorische Signale zum Kortex. Ein gestärkter SMR verbessert diese Filterfunktion und erhöht damit die Schwelle für eine anfallsartige, hypersynchrone Entladung von Neuronen.
-
Langsame kortikale Potenziale (Slow Cortical Potentials, SCPs): SCPs sind langsame Gleichspannungsverschiebungen im EEG, die die allgemeine Erregbarkeitsschwelle von kortikalen Neuronen widerspiegeln. Negative SCP‑Verschiebungen korrelieren mit erhöhter neuronaler Aktivierung und Erregbarkeit, positive mit Hemmung und reduziertem Erregbarkeitsniveau. Das SCP‑Training zielt darauf ab, dass Patient:innen lernen, ihre kortikale Erregbarkeit willentlich zu senken (d. h. in Richtung positiver SCP‑Verschiebungen), um somit die Wahrscheinlichkeit von Anfallsauslösungen proaktiv zu verringern.
Evidenz aus Übersichtsarbeiten und Meta‑Analysen
Übersichtsarbeiten und Meta‑Analysen bilden eine der höchsten Evidenzstufen in der wissenschaftlichen Hierarchie.
-
Meta‑Analyse (2009): Tan et al. (2009) untersuchten 10 Studien mit Patient:innen, deren Anfälle durch Medikamente nicht ausreichend kontrolliert waren – die Analyse ergab eine signifikante Reduktion der Anfallshäufigkeit.
-
Systematischer Review (2022): Enriquez‑Geppert et al. (2022) fassten die neuere Literatur zusammen und bestätigten die positiven Effekte von SMR‑ und SCP‑Neurofeedback – betonten jedoch gleichzeitig die Notwendigkeit methodisch hochwertiger RCTs mit aktiven Kontrollgruppen.
Evidenz aus Schlüsselstudien zu etablierten Protokollen
-
SMR‑Neurofeedback: Eine wichtige Übersichtsarbeit von Sterman & Egner (2006) zeigte die neurophysiologischen Grundlagen und die klinische Forschung zum SMR‑Training bei Epilepsie.
-
SCP‑Neurofeedback: Eine Langzeitstudie von Strehl et al. (2014) belegte, dass nach Abschluss eines SCP‑Neurofeedback‑Trainings eine nachhaltige und signifikante Reduktion der Anfallshäufigkeit auch nach zehn Jahren möglich war.
-
SMR‑RCT (2020): Jiang et al. führten eine randomisierte kontrollierte Studie durch, bei der die SMR‑Gruppe eine durchschnittliche Reduktion der Anfallshäufigkeit von etwa ‑57,8 % erzielte, im Vergleich zur Placebo‑Kontrollgruppe bzw. zur unbehandelten Gruppe.
Weitere klinisch relevante Protokolle: Der Fall des ILF‑Trainings
Neben den etablierten SMR‑ und SCP‑Protokollen gewinnt das Infra‑Low‑Frequency (ILF) Neurofeedback (auch bekannt als Othmer‑Methode) in der Praxis zunehmend an Bedeutung. Dieses Verfahren zielt auf die Regulierung extrem langsamer Hirnwellen im Frequenzbereich unter 0,1 Hz ab.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Datenlage für ILF‑Training bei Epilepsie bislang jedoch deutlich weniger robust: Die vorhandene Literatur besteht überwiegend aus Fallberichten, Fallserien und retrospektiven Beobachtungen aus der Praxis. Es fehlen bislang groß angelegte RCTs, die die spezifische Wirksamkeit des ILF‑Neurofeedbacks bei Epilepsie im Vergleich zu einer Placebo‑Bedingung oder etablierten Protokollen wie dem SMR‑Training belegen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Obwohl das ILF‑Training in der Anwendung verbreitet ist, steht der Nachweis seiner evidenzbasierten Wirksamkeit nach Kriterien der akademischen Medizin noch aus.
Prädiktoren für den Therapieerfolg
Ein wichtiger Forschungszweig beschäftigt sich mit der Frage, welche Patient:innen am meisten von einer Neurofeedback‑Therapie profitieren. So zeigte eine frühere Studie von Kotchoubey et al. (1999), dass die Fähigkeit, kortikale Potenziale gezielt in eine hemmende (positive) Richtung zu verschieben, ein entscheidender Prädiktor für den Therapieerfolg sein kann – während eine bereits bestehende Tendenz zur Übererregung als negativer Prädiktor gelten könnte.
Ergänzende Aspekte: QEEG, Z‑Score Training & Kohärenz
(Neu hinzugefügt für Erweiterung)
Ein moderner Ansatz zur Optimierung von Neurofeedback‑Protokollen liegt im Einsatz von Quantitative EEG (QEEG)‑Analysen. Mithilfe von QEEG lassen sich die Quellen neuronaler Dysregulation mit deutlich höherer räumlicher und frequenzbezogener Präzision identifizieren – dadurch kann das Trainings‑ bzw. Neurofeedback‑Protokoll noch gezielter auf individuelle Muster im Gehirn abgestimmt werden.
Darüber hinaus etabliert sich das sogenannten Z‑Score Neurofeedback – hierbei wird mit einer normativen Datenbank (z. B. die wissenschaftlich validierte QEEG‑Pro Datenbank aus den Niederlanden) gearbeitet, um Abweichungen der individuellen Hirnaktivität vom Normbereich zu erkennen und gezielt zu trainieren. Durch Z‑Score Training kann nicht nur Amplituden‑ und Frequenzverschiebung adressiert werden, sondern auch die Kohärenz (also die Synchronisation zwischen Gehirnarealen) – und gerade erhöhte oder dysfunktionale Kohärenz ist häufig mit Anfallsbereitschaft verbunden. Der gezielte Einsatz solcher erweiterten Verfahren kann somit dazu beitragen, Neurofeedback noch wirksamer und individueller zu machen.
Limitationen und Ausblick
Trotz der vielversprechenden Ergebnisse sollte die Evidenzlage kritisch betrachtet werden:
-
Methodische Heterogenität: Studien verwenden häufig unterschiedliche Protokolle, was direkte Vergleiche erschwert.
-
Kleine Stichproben: Viele ältere Studien arbeiten mit wenigen Teilnehmer:innen.
-
Kontrollgruppen: Es fehlen in zahlreichen Fällen Studien mit überzeugender „Schein‑“ oder Placebo‑Kontrollbedingung – die RCT von Jiang et al. (2020) ist hier eine wichtige Ausnahme.
-
Standardisierung: Für eine breite klinische Anwendung ist eine stärkere Standardisierung der Trainingsprotokolle notwendig.
Der Ausblick bleibt jedoch positiv: Zukünftige Forschungen werden sich verstärkt auf größere, multizentrische RCTs konzentrieren sowie auf die Kombination mit bildgebenden Verfahren (z. B. fMRT) und die Entwicklung personalisierter Trainingsprotokolle – insbesondere unter Einbezug von QEEG‑Analysen und Z‑Score‑Netzwerk‑Modellen.
Zusammenfassung der Evidenz
-
Starke Evidenz liegt für etablierte Neurofeedback‑Protokolle (insbesondere SMR und SCP) zur Reduktion der Anfallshäufigkeit bei Epilepsie vor.
-
Besonders geeignet scheint die Methode bei Patient:innen mit pharmakoresistenter Epilepsie.
-
Nachgewiesen sind auch nachhaltige Effekte: Langzeitstudien weisen darauf hin, dass die erlernte Selbstregulationsfähigkeit über Jahre anhalten kann.
-
Der Forschungsstand wächst: Neue, methodisch hochwertige Studien wie RCTs stärken die Evidenzbasis kontinuierlich.
-
Dennoch besteht weiterer Forschungsbedarf: Insbesondere gilt dies für die systematische Validierung neuer Protokolle wie dem ILF‑Training sowie für den breiteren Einsatz von QEEG‑gestützten, individualisierten Ansätzen wie Z‑Score‑Training und Kohärenz‑Modulation.
Wichtige Institutionen und Fachleute
-
Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensneurobiologie, Universität Tübingen (Prof. Ute Strehl, Prof. Boris Kotchoubey)
-
Department of Neurobiology, UCLA (Prof. M. Barry Sterman – emeritiert)
-
Deutsche Gesellschaft für Biofeedback (DGBfB) e.V.
-
International Society for Neuroregulation & Research (ISNR)
Praxisbezug: Was wir bei IFEN anbieten
Alle hier beschriebenen evidenzbasierten Neurofeedback-Trainings – SMR, SCP, Z‑Score‑Training, QEEG-gestützte Individualisierung sowie Kohärenzmodulation – werden am Institut für EEG-Neurofeedback (IFEN) nicht nur therapeutisch angewandt, sondern auch in unseren zertifizierten Fortbildungen systematisch gelehrt.
Darüber hinaus setzen wir auf innovative Entwicklungen wie das ISF-Neurofeedback (Infra-Slow Fluctuation) – basierend auf den Arbeiten von Dirk De Ridder, Paul Swingle und Sue & Siegfried Othmer. Dieses Verfahren zielt auf die langsamsten neuronalen Fluktuationen (< 0.01 Hz) und ermöglicht eine besonders tiefgreifende Selbstregulation des autonomen und zentralen Nervensystems.
Als Technologiepartner von BrainMaster Technologies (USA) bietet IFEN Zugang zu den fortschrittlichsten Systemlösungen im Bereich der Neuroregulation. Dazu gehört auch das sLORETA-Neurofeedback, mit dem gezielte Trainings tiefer gelegener Hirnstrukturen (wie z. B. Thalamus, ACC oder limbisches System) möglich werden – auf Basis hochauflösender Quellenlokalisation.
Mit dieser Kombination aus wissenschaftlich fundierter Methodik und state-of-the-art Technologie stehen IFEN-Therapeut:innen moderne und zugleich klinisch bewährte Werkzeuge zur Verfügung, um Klient:innen mit Epilepsie – und anderen neurologischen Dysregulationsmustern – individuell und effektiv zu begleiten.
Thomas F. Feiner, QEEG-D, BICA OT
Direktor des Instituts für EEG-Neurofeedback
QEEG-D, BCIA
www.neurofeedback-info.de
info@neurofeedback-info.de
+4915154603928