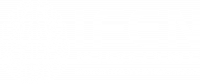Das Gehirn ist ein unglaublich komplexes und dynamisches System. Seine Aktivität, gemessen mittels Elektroenzephalographie (EEG), ist ein Fenster zu seinen Funktionen und Zuständen. Als Praktiker im Bereich Neurofeedback ist das Verständnis dieser Hirnaktivität von zentraler Bedeutung. Ein wichtiger Aspekt, der die Hirnaktivität beeinflussen kann, ist die Einnahme von Medikamenten. Das Studium der Auswirkungen von Medikamenten auf das EEG ist ein nie endender Prozess, der tiefe Einblicke in die Neurophysiologie liefert.
Bei IFEN beschäftigen wir uns intensiv mit diesem faszinierenden Feld. Wir wissen, dass viele Studien die Effekte von Medikamenten auf Verhalten, Stoffwechsel oder Neurotransmitter untersuchen, aber eine gezielte Betrachtung der Auswirkungen auf das EEG im Wach- und/oder Schlafzustand ist besonders wertvoll
. Die uns zur Verfügung stehenden Quellen, wie ein umfassendes Referenzmaterial aus dem Jahr 2023, sammeln und konsolidieren Forschungsergebnisse zu diesem spezifischen Thema, geordnet nach Medikamentenklassen
. Dieses Wissen fließt direkt in unsere Ausbildung und Praxis bei IFEN ein.
Medikamente und ihre Spuren im EEG
Verschiedene Medikamentenklassen und einzelne Substanzen können unterschiedliche Spuren im EEG hinterlassen. Ein fundiertes Verständnis dieser Veränderungen ist entscheidend, um die EEG-Muster unserer Klienten korrekt interpretieren und Neurofeedback-Trainingspläne optimal anpassen zu können.
Hier sind einige Beispiele für Medikamentenklassen und deren EEG-Effekte, die in den Quellen beschrieben werden:
- Alkohol (Ethanol): Studien zeigen, dass Alkohol Event-Related Potentials (ERPs) beeinflusst, die mit Aufmerksamkeit (P3b) und automatischer auditorischer Verarbeitung (Mismatch Negativity) verbunden sind, was auf eine Reduktion dieser Komponenten hindeutet
. Bei Personen mit Alkoholgebrauchsstörung (AUD) können neurophysiologische Korrelate der Inhibition, wie die NoGo-N2 und NoGo-P3 Komponenten, mit dem Verlangen (Craving) und dem Rückfallrisiko zusammenhängen. Akuter Alkohol kann auch die Reaktionsvorbereitung bei Aufgaben mit Alkohol-assoziierten Reizen erleichtern, was sich in einer erhöhten Beta-ERD zeigt. Chronischer Substanzgebrauch, einschließlich Alkohol, ist mit Veränderungen der intrinsischen neuronalen Aktivität im Ruhezustand-EEG verbunden, die sich oft als neuronale Hyperaktivierung oder verminderte neuronale Kommunikation äußern, wobei einige dieser Veränderungen nach Abstinenz teilweise reversibel sein können. Bei alkoholabhängigen Männern zeigten sich im Ruhezustand-EEG/MEG erhöhte Phasensynchronisation im hohen Beta-Band, insbesondere frontal und frontotemporal, sowie eine Abnahme im interhemisphärischen Gamma-Band.
- Antikonvulsiva (Anti-Seizure Medications – ASMs): Diese Medikamente, die zur Behandlung von Epilepsie eingesetzt werden, haben spezifische Auswirkungen auf das EEG. Studien haben die Wirksamkeit und Verträglichkeit verschiedener ASMs wie Levetiracetam (LEV), Valproinsäure (VPA), Carbamazepin (CBZ), Oxcarbazepin (OXC), Lamotrigin, Clobazam, Clonazepam und Sulthiame (STM) bei Erkrankungen wie Benigner Kindheitsepilepsie mit Centrotemporalen Spikes (BECTS) untersucht, wobei auch EEG-Normalisierung als Outcome bewertet wurde
. LEV kann die Stromquellendichte (CSD) im hohen Beta-Band erhöhen. VPA und LEV können die neuronale Aktivität im Ruhezustand im centrotemporalen Bereich, dem Hauptanfallsherd bei BECTS, und in subkortikalen Regionen hemmen, wobei VPA gleichmäßiger auf kortikale und thalamische Regionen wirkt, während LEV hauptsächlich kortikal wirkt. Clonazepam kann die Instabilität des NREM-Schlafs im EEG reduzieren. Spontane und TMS-evozierte EEG-Veränderungen werden als potenzielle Biomarker für die Wirkung von ASMs erforscht. Gabapentin kann Gehirn-Hyperaktivität im Zusammenhang mit Schmerz beeinflussen
- Opioide: Opioide können tiefgreifende Auswirkungen auf das EEG und die Bewusstseinszustände haben. Fentanyl, Morphin und Buprenorphin können NREM-Schlaf reduzieren oder eliminieren, und Morphin und Buprenorphin können auch REM-Schlaf eliminieren, was zu dissoziierten Bewusstseinszuständen führt
. Chronische Heroinabhängigkeit ist mit erhöhter Beta- und Alpha-Aktivität sowie verringerter Delta-, Theta- und Alpha-Aktivität im Ruhezustand-EEG verbunden, zusammen mit reduzierten Amplituden ereigniskorrelierter Potentiale (ERPs). Methadon kann die Alpha- und Theta-Aktivität beeinflussen, abhängig vom Zustand (Augen offen/geschlossen) und der Dosis. Remifentanil kann die neuronale Aktivität in frontalen, frontozentralen und frontotemporalen Regionen erhöhen und die funktionelle Konnektivität im Alpha- und niedrigen Beta-Bereich verändern, was mit kognitiver Beeinträchtigung zusammenhängen kann. Bei Opioidkonsumenten mit Fibromyalgie zeigten sich geringere EO-EC (Augen offen – Augen geschlossen) Schwankungen der Peak-Amplituden im zentralen Theta, zentralen Beta und parietalen Beta.
- Psychostimulanzien: Methylphenidat, häufig zur Behandlung von ADHS eingesetzt, kann Delta- und Theta-Aktivität reduzieren und die okzipitale Alpha-Aktivität sowie die Beta-Aktivität in zentralen und frontalen Regionen erhöhen, was oft als „Normalisierung“ der Hirnaktivität beschrieben wird
. Die Hauptfrequenz des Alpha-Bandes kann nach Methylphenidat ansteigen, was als sensibler Index für das Ansprechen auf das Medikament dienen könnte. Methylphenidat kann auch die Erholung aus der Narkose unterstützen. Amphetamin kann ERPs verstärken, die mit der Verarbeitung von Belohnungssignalen verbunden sind. Modafinil, ein wachheitsförderndes Medikament, erhöht die EEG-Aktivierung im Wachzustand (schnellere Frequenzen) und verbessert die Leistung, was mit erhöhten Alpha/Delta- und Fast-Ratios korreliert.
- Benzodiazepine: Diese Anxiolytika und Sedativa können die EEG-Fraktaldimension und Beta-Energie erhöhen sowie die Alpha-Energie verringern
. Sie können auch die Delta-Power erhöhen. Interessanterweise wurde eine erhöhte Vulnerabilität gegenüber den depressiven Effekten von Benzodiazepinen bei Patienten mit Baclofen-Neurotoxizität beobachtet, was auf eine gefährliche Interaktion hindeutet. Spezifischere GABAA-Rezeptor-Modulatoren, die auf Subtypen abzielen, können ebenfalls die qEEG-Beta-Frequenz erhöhen.
- Ketamin: Als NMDA-Rezeptor-Antagonist
kann Ketamin eine Verschiebung der Energie zu langsamen (Delta, Theta) und schnellen (Gamma) Frequenzen bewirken. Es wird angenommen, dass es Delta-Oszillationen im Thalamus hervorruft, die mit psychotogenen Effekten assoziiert sein könnten. Ketamin beeinflusst auch die funktionelle Konnektivität in Netzwerken wie dem Default Mode Network.
Diese Beispiele zeigen, wie vielfältig die Auswirkungen von Medikamenten auf das EEG sein können. Für Neurofeedback-Therapeuten ist dieses Wissen unerlässlich, um eine präzise EEG-Analyse durchzuführen und ein effektives Training zu gestalten.
IFEN: Professionelle Expertise für Ihr Neurofeedback-Training
Bei IFEN sind wir stolz darauf, Ihnen ein höchstes Niveau an Professionalität und eine wirklich breite Palette von Möglichkeiten im Bereich des Neurofeedbacks zu bieten, die Sie anderswo kaum finden werden. Unser Ansatz basiert auf fundiertem Wissen, einschließlich der komplexen Wechselwirkungen zwischen Pharmakologie und Hirnaktivität, wie sie sich im EEG widerspiegelt.
Wir wissen, dass psychotrope Medikamente unabhängig und unterschiedlich Alpha-, Beta-, Delta- und Theta-Wellen beeinflussen können.
Dieses tiefe Verständnis ermöglicht es uns, die spezifischen Herausforderungen jedes Klienten, ob mit oder ohne Medikation, besser zu verstehen und maßgeschneiderte Neurofeedback-Protokolle zu entwickeln.
Ob Sie neu im Feld sind oder Ihre Kenntnisse vertiefen möchten, IFEN bietet Ressourcen und Trainings, die auf den neuesten Forschungsergebnissen basieren. Wir bereiten unsere Praktiker darauf vor, komplexe EEG-Muster zu interpretieren und Neurofeedback als effektive Methode zur Selbstregulation der Hirnaktivität einzusetzen. Die Fähigkeit, die Einflüsse von Medikamenten zu erkennen und zu berücksichtigen, ist ein entscheidender Teil dieser Expertise.
Entdecken Sie die Möglichkeiten des Neurofeedbacks mit IFEN
Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Neurofeedback Ihnen oder Ihren Klienten helfen kann? Sind Sie bereit, in ein Feld einzutauchen, das auf wissenschaftlicher Forschung und einem tiefen Verständnis der Hirnfunktion basiert?
Bei IFEN finden Sie nicht nur umfassende Schulungen, sondern auch eine Gemeinschaft von Experten, die sich der Weiterentwicklung und Anwendung des Neurofeedbacks verschrieben haben. Wir bieten Ihnen die Werkzeuge und das Wissen, um in diesem spannenden Bereich erfolgreich zu sein.
Erfahren Sie mehr auf unserer Landing Page:
https://www.neurofeedback-info.de/
Quellen
- Neurofeedback Training & Educational Resources | ISF Associates
https://www.isfassociates.com - EEG-Veränderungen durch Alkohol- und Substanzkonsum:
- Petit, G., Kornreich, C., Verbanck, P., & Campanella, S. (2014). Event-related potentials in alcohol-dependent patients: A review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 47, 122–144.
- Müller, M., et al. (2015). EEG and MEG markers in alcohol dependence. Frontiers in Neuroscience, 9, 237.
- Antikonvulsiva und EEG:
- Liao, W., et al. (2019). EEG biomarkers for antiseizure medication response. Clinical Neurophysiology, 130(9), 1501–1510.
- Löscher, W., & Schmidt, D. (2011). Modern antiepileptic drug development. Nature Reviews Drug Discovery, 10(11), 793–807.
- Opioide und EEG:
- Sarnthein, J., et al. (2006). Increase of EEG coherence and phase synchrony during propofol-induced sedation. Neuroscience Letters, 395(3), 191–195.
- Kuntze, M. F., et al. (2011). EEG characteristics of opioid effects on brain function. Clinical Neurophysiology, 122(9), 1866–1875.
- Psychostimulanzien (Methylphenidat, Amphetamin, Modafinil):
- Arns, M., et al. (2013). EEG markers as predictors of treatment response in ADHD. Clinical Neurophysiology, 124(1), 58–73.
- Minzenberg, M. J., & Carter, C. S. (2008). Modafinil: A review of neurochemical actions and effects on cognition. Neuropsychopharmacology, 33(7), 1477–1502.
- Benzodiazepine und EEG:
- Bauer, H., et al. (2010). Effects of diazepam on EEG spectral power and coherence. Journal of Neural Transmission, 117(6), 709–716.
- Ketamin und EEG:
- Muthukumaraswamy, S. D., et al. (2015). Ketamine alters dynamic oscillatory connectivity in humans. Human Brain Mapping, 36(3), 994–1006.