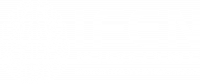Als Thomas F. Feiner, Neurofeedback- und QEEG-Experte sowie Direktor des Instituts für EEG-Neurofeedback, werde ich oft gefragt, welcher Ansatz im Neurofeedback der „richtige“ sei. Sollten wir uns auf Symptome, Diagnosen oder die reinen Daten konzentrieren? Meine Antwort ist klar: Der effektivste Weg integriert diese Aspekte, aber mit einer klaren Priorisierung der Daten. Lass uns das genauer beleuchten und verstehen, warum gerade der datenorientierte Ansatz den Unterschied macht.
Symptombasierte Protokolle: Der einfache, aber tückische Einstieg
Viele Kolleg:innen starten ihren Neurofeedback-Weg, indem sie sich stark an den Symptomen ihrer Klient:innen orientieren und dafür vordefinierte Protokolle anwenden. Ein klassisches Beispiel: Bei Schlafstörungen wird Alpha-Theta im Okzipitalbereich trainiert, oder bei ADHS die Reduktion von Theta- und die Erhöhung von Beta-Wellen im Frontalbereich.
Die Anziehungskraft liegt auf der Hand: Symptombasierte Protokolle sind einfach zu erlernen und anzuwenden, da sie keine komplexe QEEG-Analyse erfordern. Sie bieten eine direkte Verbindung zwischen Symptom und Training, was intuitiv erscheint.
Doch genau in dieser Einfachheit liegt die zentrale Problematik:
Die Tücken der Simplizität
- Polykausalität von Symptomen: Ein und dasselbe Symptom kann durch völlig unterschiedliche neuronale Dysregulationen verursacht werden. Schlafstörungen können beispielsweise durch überaktive Beta-Wellen, zu wenige Alpha-Wellen oder Dysregulationen im autonomen Nervensystem entstehen. Ein generisches „Schlafprotokoll“ würde bei allen dreien angewendet, aber nur bei demjenigen wirklich effektiv sein, dessen neuronales Muster zufällig zum Protokoll passt. Bei anderen könnte es wirkungslos oder sogar kontraproduktiv sein.
- Mangelnde Individualisierung: Jedes Gehirn ist einzigartig. Symptombasierte Protokolle ignorieren diese Individualität. Sie behandeln eine Diagnose oder ein Symptom, nicht das einzigartige Gehirn des Klienten. Das führt oft zu suboptimalen Ergebnissen, Frustration und potenziellen unerwünschten Effekten.
- Fehlende objektive Fortschrittsmessung: Ohne eine Baseline-QEEG-Messung und regelmäßige Follow-up-QEEGs ist es schwierig, den Fortschritt objektiv auf neuronaler Ebene zu messen.
Diagnoseorientierte Protokolle: Eine Brücke, die oft zu kurz ist
Der nächste Schritt, den viele gehen, ist der diagnoseorientierte Ansatz. Wenn eine Klientin mit einer ADHS-Diagnose kommt, werden Neurofeedback-Protokolle angewendet, die sich auf typische ADHS-Muster konzentrieren. Das ist schon präziser als der rein symptombasierte Ansatz.
Doch auch hier gibt es eine entscheidende Schwachstelle: Eine Diagnose wie ADHS ist ein breites Spektrum. Zwei Personen mit der gleichen Diagnose können neurophysiologisch völlig unterschiedliche Profile aufweisen. Eine mag ein stark erhöhtes Theta/Beta-Verhältnis haben, die andere vielleicht eine Auffälligkeit in der Konnektivität bestimmter Gehirnbereiche. Eine einzige Diagnose deckt diese individuelle Varianz nicht ab. Wenn wir uns blind auf Diagnosen verlassen, riskieren wir, generische Protokolle anzuwenden, die nicht optimal auf die spezifischen Bedürfnisse des individuellen Gehirns zugeschnitten sind.
Datenorientiertes Neurofeedback: Der Goldstandard für Präzision
Mein klarer Favorit und der Kern unserer Arbeit am Institut für EEG-Neurofeedback ist der datenorientierte Ansatz. Hier nutzen wir präzise QEEG-Messungen (Quantitative Elektroenzephalographie), um ein detailliertes Bild der Gehirnaktivität zu erhalten. Tools wie QEEG Pro oder das Swingle Assessment liefern uns nicht nur rohe EEG-Daten, sondern analysieren diese umfassend und vergleichen sie mit altersentsprechenden Normdatenbanken.
Was bedeutet das in der Praxis?
- Individualisierte Mustererkennung: Statt uns auf eine Diagnose zu verlassen, schauen wir uns die spezifischen Dysregulationen im Gehirn an. Wo gibt es Abweichungen in Frequenzbändern (z.B. zu viel langsame oder schnelle Wellen)? Wie steht es um die Kohärenz, die Phase oder die Asymmetrien zwischen verschiedenen Hirnarealen?
- Symptom-Daten-Verknüpfung: Wir verknüpfen die berichteten Symptome der Klient:innen mit den objektiv gemessenen neuronalen Daten. Wenn jemand beispielsweise über Konzentrationsschwierigkeiten klagt, suchen wir im QEEG nach Mustern, die typischerweise damit assoziiert sind, z.B. übermäßige Theta-Aktivität im Frontalhirn oder Auffälligkeiten in den Aufmerksamkeitsnetzwerken.
- Präzise Protokollentwicklung: Basierend auf diesen Daten und in Verbindung mit den Symptomen entwickeln wir hochspezifische Neurofeedback-Protokolle. Statt eines generischen „ADHS-Protokolls“ erstellen wir ein Protokoll, das genau auf die individuellen Hirnwellenmuster der Person zugeschnitten ist – sei es die Normalisierung von Alpha-Asymmetrien bei Angststörungen oder die Stärkung spezifischer Konnektivitätsmuster bei Trauma.
Dieser datenorientierte Ansatz ermöglicht es uns, die Ursachen der Symptome auf neuronaler Ebene anzugehen und nicht nur die Symptome selbst zu behandeln. Das führt zu nachhaltigeren und oft schnelleren Ergebnissen.
Der Einstieg ins Z-Werte-Training: Weniger ist oft mehr
Ein häufiger Übergangsbereich für viele Kolleg:innen ist der Wechsel vom Amplituden- zum Z-Werte-Training. Viele stehen dabei vor ähnlichen Überlegungen. Was den Einstieg ins Z-Werte-Training betrifft: Ich empfehle, sich zunächst zwei bis drei auffällige Parameter aus dem QEEG herauszugreifen. Das können zum Beispiel funktionelle Netzwerke oder auffällige Asymmetrien sein. Konzentriere dich auf diese und starte gezielt damit. Du kannst dabei mit 4 Kanälen bereits sehr viel erreichen, insbesondere wenn es pragmatisch bleiben soll. Das 19-Kanal-Training hat natürlich zusätzliche Möglichkeiten, kommt aber meist später und gezielt zum Einsatz.
Indem du dich auf einige wenige, aber relevante Parameter konzentrierst, kannst du schnell Erfolge erzielen und ein Gefühl für die Arbeitsweise mit Z-Werten entwickeln. Dies schafft Vertrauen und Motivation für komplexere Anwendungen.
Wie mache ich es richtig? Eine Integration der Ansätze
Der „richtige“ Weg im Neurofeedback ist meiner Meinung nach eine Integration, bei der die Daten das Fundament bilden:
- Startpunkt Symptom: Beginne immer mit den Symptomen und der Anamnese des Klienten. Diese geben dir erste Hinweise auf mögliche Problembereiche.
- Objektivierung durch Daten: Führe ein umfassendes QEEG durch. Dies ist entscheidend, um die neuronalen Korrelate der Symptome objektiv zu erfassen. Die Daten werden dir zeigen, wo die tatsächlichen Dysregulationen liegen.
- Protokollentwicklung basierend auf Daten: Erstelle deine Neurofeedback-Protokolle primär auf Basis der QEEG-Daten. Nutze die Symptome und gegebenenfalls Diagnosen als Rahmen, aber lass dich von den detaillierten neuronalen Mustern leiten.
- Kontinuierliche Anpassung: Neurofeedback ist ein dynamischer Prozess. Überprüfe regelmäßig die Fortschritte (sowohl symptomatisch als auch datenbasiert) und passe deine Protokolle entsprechend an.
Indem wir die Kraft der präzisen QEEG-Daten nutzen, können wir Neurofeedback von einem allgemeinen Ansatz zu einer hochindividualisierten und damit wesentlich effektiveren Therapieform entwickeln. Das ist der Weg, den wir am Institut für EEG-Neurofeedback lehren und leben – für die besten Ergebnisse bei unseren Klient:innen.
Wenn du tiefer in die Materie eintauchen oder persönliche Unterstützung beim Übergang zum datenorientierten Neurofeedback suchst, steht dir unser Mentoring-Programm zur Verfügung. Unser Team, darunter erfahrene Expertinnen wie Hany, begleitet dich individuell und praxisnah.